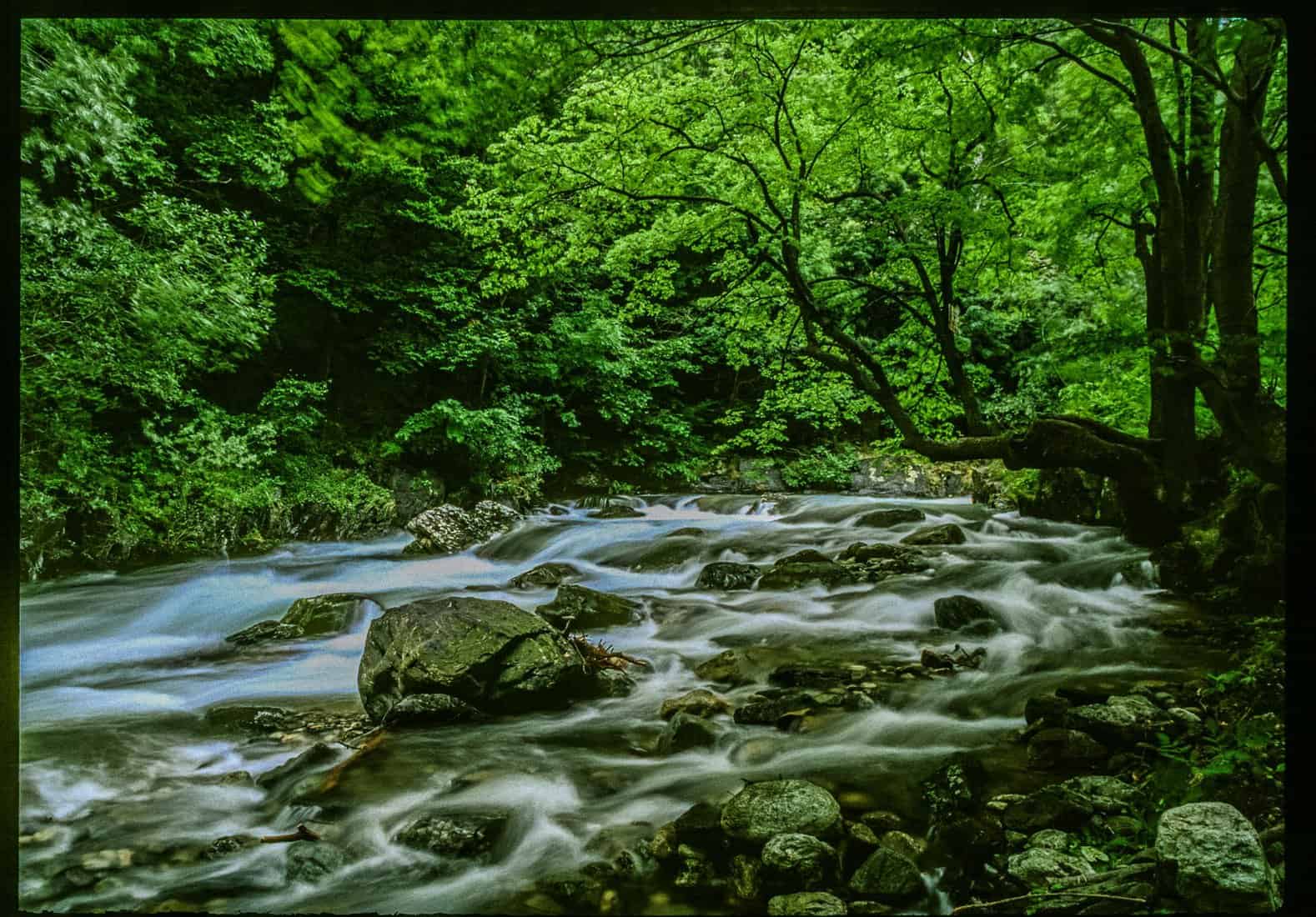Nachhaltige Waldwirtschaft versteht den Wald als Ökosystem, das unterschiedlichste Funktionen erfüllen sollte und sich nicht nur auf den Aspekt der Holzproduktion stützt. Nachhaltige Waldwirtschaft wird als ein Oberbegriff für mehrere Wirtschaftsweisen und Modellen verwendet. Die naturnahe Waldwirtschaft ist eines davon. Dass der Wald wichtig für uns Menschen und die Umwelt ist, vor allem in Zeiten des Klimawandels, ist klar und auch in diversen Gesetzen aufgeführt, wie zum Beispiel dem Bundeswaldgesetz in Deutschland von 1975. Doch der Begriff der Nachhaltigkeit und das vorausschauende Bewirtschaften eines Waldes geht noch viel weiter zurück. Vor mehr als 200 Jahren prägte Hans Carl von Carlowitz in seinem Werk „Sylvicultura oeconomica“ den Begriff der Nachhaltigkeit in Bezug auf den Wald. Er erkannte, dass der Wald so zu bewirtschaften ist, dass auch die Nachkommen noch ausreichend Holz zur Verfügung haben.
Im Klartext bedeutet dies nur so viel Holz zu entnehmen, wie auch nachwachsen kann. Denn die Bäume, die jetzt wachsen, werden erst von unseren Enkeln genutzt. Weiterhin soll auf den Boden mit Flora und Fauna ein besonderes Augenmerk gelegt werden, da diese für das gesamte System wichtig sind und eine Grundlage für einen stabilen Wald bieten. Im Allgemeinen werden bei der nachhaltigen Waldwirtschaft alle Leistungen des Waldes und der Dauerhaftigkeits-Gedanke berücksichtigt.
Die naturnahe Waldwirtschaft ist eine von drei waldwirtschaftlichen Konzepten mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit. Die zwei anderen Konzepte sind die naturgemäße Waldwirtschaft und die ökologische Waldwirtschaft. Die naturnahe Waldwirtschaft, orientiert sich, wie der Name schon andeutet, an Prozessen, die ohne den Eingriff von Menschen stattfinden würden, und nutzt diese für Bewirtschaftungsmaßnahmen. Sie versucht den ursprünglichen Zustand der Urwälder wiederherzustellen bzw. anzugleichen. Diese Prozesse, wie beispielsweise Naturverjüngung, sollen möglichst effizient und risikosenkend in ökonomischer und ökologischer Hinsicht ausgenutzt werden.
Ein maßgebliches Ziel ist es, die vorhandenen Baumarten, die das Landschaftsbild natürlicherweise prägen würden, zu fördern und stabile Mischwälder zu schaffen. Die Mischwälder sollten aus verschiedenen Altersstufen bestehen und strukturreich sein. Auch gilt ein Augenmerk auf das Prinzip „Klasse statt Masse“ zu legen. Das bedeutet, dass einzelne, am besten hochwertige und starke Bäume, geerntet werden, der Bestand aber stetig weiterwächst. Ein Kennzeichen für naturnahe Waldwirtschaft ist die waldbauliche Umwandlung von den Nadelreinbeständen hin zu Mischwäldern mit zum Beispiel erhöhtem Anteil von Rotbuche (Fagus sylvatica), Trauben-Eiche (Quercus petraea)oder Stiel-Eiche (Quercus robur). Dazu gehört natürlich auch die standortsgemäße Baumartenwahl, sowie die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit, um einen Dauerwald zu begünstigen und möglichst auch keine Kahlschläge vorzunehmen. Auf Düngemittel, Herbizide, Insektizide, und andere Einsatzmittel ist zu verzichten und ökosystemverträgliche Wildbestände sollte man zulassen.
Auch bewegt sich die naturnahe Waldwirtschaft hin zu einem multifunktionalen Wald und versucht die Prozesse der Fläche abzustimmen. Der naturnahe Waldbau beinhaltet als Kernpunkte sechs verschiedene Elemente. Zum einen sind das die standortgerechte Baumartenwahl sowie die Naturnähe des Waldes im Allgemeinen. Mischwälder mit verschieden alten und großen Bäumen sind ein weiterer wichtiger Aspekt. Dabei sollte die ökologische und physikalische Stabilität der Wälder mitberücksichtigt werden. Einer der Hauptaugenmerke liegt dabei auf der Naturverjüngung, die unter anderem durch angepasste Wildbestände erreicht wird. Augenmerk sollte auf der angepassten Pflege der Bestände liegen, und zwar in der qualitäts- und stabilitätsorientierten Pflege. Weiterhin sind der integrierte Waldschutz und die pflegliche Waldarbeit auch Teile der naturnahen Waldwirtschaft. Bei allen Konzepten sollten die Interessen der verschiedenen Akteure mit einbezogen werden.
Bestandszieltypen
In Deutschland werden Bestandszieltypen oder Waldbaurichtlinien für die einzelnen Bundesländer entwickelt und bieten Praktikern ein Nachschlagwerk zur Orientierung. In diesen Dokumenten werden Bestimmungen zur Baumartenzusammensetzung in einer praktischen Anleitung für den Waldbau geliefert. Hauptsächlich geben und gelten die Bestandszieltypen für die öffentlichen Wälder, die in Deutschland von den einzelnen Bundesländern bewirtschaftet werden. Allerdings haben auch bei anderen Nutzungsformen, wie zum Beispiel im Privat- oder Körperschaftswald diese Richtlinien eine große Bedeutung.
Die Waldbaurichtlinien gelten allgemein und beschreiben die Grundsätze für den Waldbau. Der Bestandszieltypenerlass bestimmt noch einmal genauer, wie geeignet Baumarten bzw. Baumartenzusammensetzungen für verschiedene Standorte sind. Als höchstes Ziel der Waldwirtschaft steht die nachhaltige Waldentwicklung im Vordergrund. Es ist wichtig die Baumarten passend zu den jeweiligen Standorten zu wählen, da dies schon die erste Hürde ist, die über Erfolg und Misserfolg entscheiden kann. Der Grundsatz der waldökologischen Orientierung ist die Naturnähe, die sich auch in den Bestandszieltypen widerspiegelt. Naturnähe fördert stabile Bestandsstrukturen und naturschutzfachliche Anforderungen. Auch die Wirtschaftszielorientierung ist ein wichtiges Leitprinzip, das befolgt werden sollte. Es misst sich an Wert- und Volumenleistungserwartungen der Bestände.
Naturnähe und Wirtschaftlichkeit
Bestandszieltypen sind mittel- bis langfristige Zielsetzungen für einen Bestandsaufbau, der ausgehend vom Bestandszustand angestrebt wird. Nicht standortgerechte Bestandszustände sollten so zeitnah wie möglich in Richtung eines geeigneten Bestandszieltyps entwickelt werden. Bestandszieltypen beschreiben eine „während des gesamten Bestandslebens planmäßig zu gestaltende, standortsgerechte Bestockung, die sich im Hiebsreifealter der Hauptbaumart durch die Zusammensetzung nach Haupt- und Mischbaumarten sowie durch den vertikalen und horizontalen Bestandsaufbau auszeichnet“.
Ein Hauptpunkt der Bestandszieltypen sind die Stamm-Standortsformengruppen, aus denen sich die Bestände zusammensetzen. Diese sind jeweils noch nach den Klimastufen getrennt in feuchtes, mäßig trockenes und trockenes Tieflandklima. Zu der konkreten Bestandszieltypenwahl gehören, auf die Hauptbaumarten bezogen, die Grundsätze der Standortsgerechtigkeit, der Naturnähe und der Wirtschaftszielorientierung. Die neuen Bestandszieltypen sind entsprechend in Baumarten und Baumartenanteile, Bestandsstruktur, Leistungserwartung für Wertholz, Entstehung des Bestandszieltyp, mögliche Standortseinheiten, Waldentwicklungsstadien und charakteristische Waldbiotoptypen eingeteilt.
Der naturnahe Waldbau ist in Deutschland in Landesgesetzen festgehalten und somit Grundlage für die Waldwirtschaft. Das Leitbild ist, wie oben schon erwähnt, ein gemischter, strukturierter und naturnaher Wald. Diese Wälder haben häufig eine geringere Anfälligkeit gegenüber biotischen und abiotischen Gefahren. Weiterhin sollen die Wälder standortgerecht und stabil sein, um die auch die Nutzungsmöglichkeiten langfristig zu sichern.
Gemeinsamkeiten der Bundesländer
Trotz der unterschiedlich aufgebauten Bestandszieltypen gibt es auch Gemeinsamkeiten bei angeratenen Zusammensetzungen, Vorschlägen und Richtlinien der verschiedenen Bundesländer.
Beispielhaft wird hier der Bestandszieltyp Rotbuche (Fagus sylvatica) – Grüne Douglasie (Pseudotsuga menziesii var. menziesii) aus Brandenburg dargestellt, welcher sich in ähnlicher Form in anderen Bundesländer findet und im Hinblick auf den Klimawandel für viele Standorte geeignet ist. Aus den Brandenburgischen Tabellen hervor, dass die Buche als Hauptbaumart mit 50 bis 70% Anteil vorkommen sollte. Die vertikale Bestandsstruktur, also die Schichtung, ist für Haupt- und Mischbaumarten so vorgesehen, dass durch frühzeitige waldbauliche Eingriffe eine vertikale Differenzierung des Bestands anzustreben ist. Dabei wird die Schnellwüchsigkeit der Douglasie ausgenutzt. Auch sollte der Unterstand vorwiegend aus Rotbuchen bestehen. Der Stammdurchmesser auf Brusthöhe beim Fällen der Buchen sollte im Optimalfall 55 bis 65 cm betragen. Das ist nach 120 bis 160 Jahren erreicht. Der Buchenbestand sollte vorzugsweise durch Naturverjüngung entstehen. Ist dies nicht der Fall, können auch Pflanzung oder die Übernahme von Unterbauten eine Möglichkeit sein.
Die Grüne Douglasie als Mischbaumart sollte einen Anteil von 20 bis 40 % ausmachen und eher einzeln unter die Buchen gemischt sein. Der gewünschte Stammdurchmesser beträgt mindestens 50 cm und die Wuchszeit 80 bis 120 Jahre. Entstehen sollte die Mischungsschicht durch Naturverjüngung, Nachbau und Ergänzung. Die Begleitbaumarten sollten ca. 10 % des Bestandes ausmachen und durch Naturverjüngung natürlich wächsen. Begleitbaumarten können beispielsweise Traubeneiche, Hainbuche, Gemeine Kiefer, Gemeine Fichte, Küstentanne, Eberesche und Gemeine Birke sein. Diese sind in der Bestandsstruktur einzelstammweise im Bestand verteilt und kommen meistens im Bereich der Bestandsränder vor. Dieser Bestandszieltyp entspricht dem sogenannten Schlusswaldstadium und ist einer von natürlichen Buchenwaldgesellschaften veränderter Waldtyp, der durch die Einbringung von Douglasien geändert wird. Dieser Typ ist aber zum Beispiel nicht für Böden mit erhöhter Staunässegefahr sowie hochanstehendem Kalk und Lehmsubstraten geeignet. Geeignete Nährstoffkraftstufen und Bodenformen sowie Humusformen und Klimastandorte werden in den Unterlagen der Bestandszieltypen aufgeführt.
Geltung in Österreich
Aus dem oben genannten Beispiel der Bestandszieltypen können Ansätze und Vorschläge auch auf Österreich angewendet werden. Natürlich sollten die Ausgangslage und Bedingungen vor Ort berücksichtigt und jeweils angepasst werden.
Zum Beispiel ist der Weg in Richtung Mischwälder für alle europäischen Länder eine gute Idee und sollte überall in Gang gebracht werden. Daher ist für die Fichten-Monokulturen in den Bergwäldern Österreichs ein Umbau in Richtung Bergmischwälder sinnvoll. Dadurch werden die Wälder resilienter, stabiler und können so wieder natürlichen Schutz gegen Erosionen, Lawinen und andere Gefahren bieten. Ein weiterer positiver Effekt ist die Luftreinigung und Wasserhalte- sowie Wasserfilterfähigkeit. Der oben genannte Bestandszieltyp kann auch in vielen Regionen Österreichs eine Option darstellen. Die Douglasie eine gute Baumartenwahl für die Zukunft dar, ebenso die Buche, die ihren natürlichen Verbreitungsraum in Europa hat. Aus den Bestimmungen der Bestandszieltypen können also auch für Österreich Waldbaustrategien abgeleitet werden.
Waldstrategieplan 2020+
Eine weitere Möglichkeit, um den Waldbau in eine nachhaltigere und zukunftsorientierte Richtung zu lenken ist der Waldstrategieplan 2020+. Dies ist ein vom österreichischen Ministerium herausgegebener Plan, der Strategien für die Waldwirtschaft darlegt. Er wurde durch Walddialog-Beteiligte erarbeitet und es ist ein eigenes Arbeitsprogramm für dessen Umsetzung erarbeitet worden. Das Programm enthält konkrete Maßnahmen und ist somit das Umsetzungsinstrument der Waldstrategie. Es soll laufend weiterentwickelt und angepasst werden.
Das Hauptaugenmerk des Strategieplans liegt auf der nachhaltigen multifunktionalen Waldwirtschaft, die ökologische, ökonomische und soziale Aspekte berücksichtigt. Es sind sieben Punkte aufgelistet, die als Orientierungspunkte gelten sollen, und zwar:
1. Beitrag der österreichischen Wälder zum Klimaschutz
2. Gesundheit und Vitalität der österreichischen Wälder
3. Produktivität und wirtschaftliche Aspekte der österreichischen Wälder
4. Biologische Vielfalt in Österreichs Wäldern
5. Schutzfunktionen der österreichischen Wälder
6. Gesellschaftliche und volkswirtschaftliche Aspekte der österreichischen Wälder
7. Österreichs internationale Verantwortung für nachhaltige Waldbewirtschaftung
Dem Wald stehen viele Erwartungen und Ansprüche entgegen. Er soll Lebensraum, Erholung, Wasserfilter, Schutz gegen Lawinen und Kohlenstoffspeicher bieten. Das sind viele Aufgaben für ein komplexes Ökosystem. Da so viele Anforderungen an den Wald bestehen, sollte es klar sein wie wichtig sein Schutz ist. Die Ansprüche an ihn werden aber immer höher, weshalb es wichtig ist ihn nachhaltig zu bewirtschaften und bedacht mit ihm umzugehen. Um solche Reglements für die Waldbesitzer zu bieten, gibt es diese Handlungsvorgaben/-anregungen des Waldstrategieplans.
Richtlinien des ÖBF
Auch von den österreichischen Bundesforsten (ÖBF) wird eine ökologische und naturnahe Waldwirtschaft angestrebt. Zwar sind dessen Vorgaben nur für die Landesforste zwingend, allerdings können diese Leitsätze und Prinzipien natürlich auch von privaten Waldbesitzern verwendet werden. Die waldbaulichen Strategien sind in einem weiteren Heft zusammengestellt, welches als Orientierungspunkt dienen sollte. Auch hier wird das Augenmerk auf naturgemäße und ökologische Waldwirtschaft gelegt, da nur so die multifunktionalen Anforderungen an den Wald erfüllt werden können. So steht auch in Österreich die natürliche Baumartenzusammensetzung im Vordergrund, welche standortsgerecht eingesetzt werden sollte. Im Klartext bedeutet das Bäume aus der potenziell natürlichen Vegetation der jeweiligen Region zu verwenden.
Des Weiteren wird auch auf die Naturverjüngung ein Augenmerk gelegt, durch die neue Bestände begründet werden sollen. Auch die Biodiversität spielt eine große Rolle in der naturnahen Waldbewirtschaftung. Diese soll gefördert werden und Kleinstrukturen/-biotope sowie Besonderheiten erhalten bleiben. Es werden also Wälder angestrebt, die standortangepasst, gesund, gut strukturiert und stabil sind. Dabei sollen die Wälder auch wertvolles Holz liefern, um den wirtschaftlichen Nutzen zu integrieren.
Ein weiteres Augenmerk wird aktuell auf den Klimawandel gelegt. Dabei ist bei Wäldern besonders auf die Resilienz zu achten sowie auf die Anpassung an wärmere Temperaturen und erhöhte Schadereignisse bei der Baumartenwahl.Um in einem konkreten Bestand Ziele zu formulieren und später zu erreichen, ist es zuerst wichtig aktuelle waldbaulichen Planungen und Grundlagen zu analysieren, die sich an den natürlichen Gegebenheiten des jeweiligen Bestandes orientieren. Wichtig ist den vorliegenden Standort genau zu bestimmen, was für ein Bestand gewünscht ist und wie dieser erreicht werden kann. Durch diese Bestimmungen kann für jeden Waldbesitzer mit den vorgegebenen Kriterien eine naturgemäße Waldwirtschaft/-strategie geplant werden. Die Bestandszieltypen aus Deutschland haben mit den verschiedenen Strategien in Österreich viele Gemeinsamkeiten, die auch individuell von Förstern übernommen werden können.